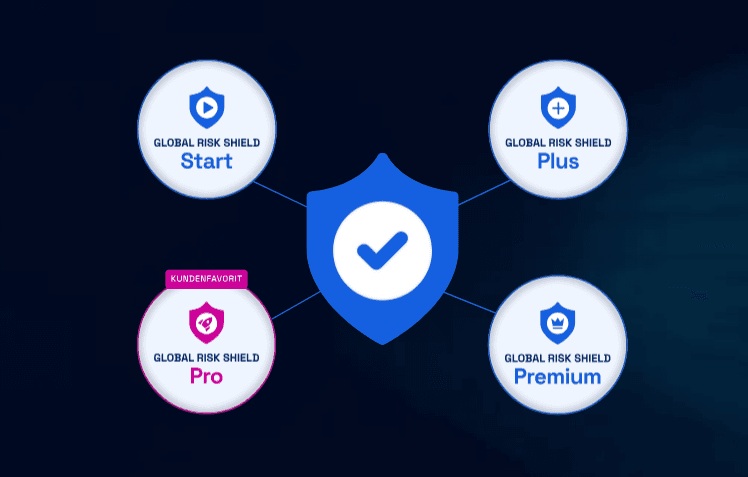Infrastruktur als strategisches Machtinstrument: Chinas maritime Seidenstraße & Häfen im Spannungsfeld geopolitischer Konflikte und ihre Folgen für die Logistikbranche
Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals in der LOGISTIK & RECHT, Nr. 02/2025, und wurde für die AKE | SKABE Insights adaptiert und aktualisiert.
Wie Ihr Unternehmen jetzt reagieren muss
Die internationale Logistikbranche steht an einem geopolitischen Wendepunkt. Weltweit nehmen politische Spannungen zu, Handelskonflikte verschärfen sich, und Infrastruktur wird immer deutlicher als strategisches Machtinstrument erkannt. In diesem Aufsatz betrachte ich die maritime Seidenstraße Chinas als maritimen Teil der Belt and Road Initiative (BRI). Diese entwickelt sich zu einem Hebel geopolitischer Einflussnahme, der weit über wirtschaftliche Interessen hinausreicht.
Für Reedereien, Logistikdienstleister, Verlader, Versicherer und Regulierungsbehörden stellt sich daher die Frage, welche Risiken, Abhängigkeiten und Handlungsoptionen sich aus Chinas globaler Hafenstrategie ergeben. Dieser Beitrag analysiert aktuelle Entwicklungen, beleuchtet die wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen auf die Logistikbranche und gibt Handlungsempfehlungen zur Risikominimierung und Stärkung der Unternehmensresilienz.

Manuel Grubenbecher ist langjähriger geopolitischer Sicherheitsberater für Unternehmen, staatliche Institutionen sowie NGOs. Sein Schwerpunkt ist das globale Risikomanagement.

Aktuelle geopolitische Entwicklungen: Handelskonflikt USA–China und neue Blockbildungen
Die geopolitische Landschaft im Frühjahr 2025 ist geprägt von einer dramatischen Verschärfung der wirtschaftlichen Rivalität zwischen den USA und China. Im März und April 2025 verhängte die US-Regierung unter Präsident Trump umfassende Strafzölle weltweit und speziell auf Chinas zentrale Industriesektoren wie Solarmodule, Elektrofahrzeuge, Halbleiter und Hightechkomponenten. Offiziell begründet wurden diese Maßnahmen mit Marktverzerrung durch Subventionen, nationalen Sicherheitsbedenken und unfairer Wettbewerbspolitik. China konterte mit Gegenzöllen auf US-Agrarprodukte und Flüssigerdgas sowie mit Exportrestriktionen bei seltenen Erden, die für Hightechproduktion und die Rüstungsindustrie unverzichtbar sind. Parallel wurden auf beiden Seiten die Investitionskontrollen verschärft, insbesondere bei kritischen Infrastrukturen, sodass chinesische Beteiligungen in westlichen Ländern zunehmend auf regulatorische Hürden stoßen. Bis Oktober 2025 verschärfte sich der Zollstreit rund um Hafen- und Schiffsgebühren. Im Zuge dessen wurden deutliche höhere Zollsätze angekündigt.
Für international tätige Unternehmen verschärft sich dadurch das Risikoumfeld. Rechtliche Unsicherheiten bei Verträgen, Transport- und Lizenzvergaben, der Verlust von Planbarkeit durch kurzfristige Exportkontrollen und politische Maßnahmen sowie verschärfte Investitionsprüfungen stellen erhebliche Herausforderungen dar. Gerade in der Logistikbranche, wo langfristige Planung, Effizienz und Rechtssicherheit zentrale Erfolgsfaktoren sind, wird die Frage nach Abhängigkeiten und Diversifizierungsstrategien immer dringlicher.
Chinas Hafenstrategie als geopolitisches Machtinstrument
Im Rahmen der BRI verfolgt China eine ehrgeizige Hafenstrategie, die auf langfristige Präsenz und Einflussnahme in Schlüsselregionen abzielt. Nach der MERICS-Studie (April 2024) verfügen chinesische Staatsunternehmen wie COSCO, Hutchison Ports und China Merchants Port über Beteiligungen in mehr als 90 Häfen in über 50 Ländern. Die Engagements reichen von Südostasien, Afrika und dem Nahen Osten bis nach Europa, darunter zentrale Knotenpunkte wie Piräus (Griechenland), Hamburg (Deutschland), Djibouti (Horn von Afrika), Gwadar (Pakistan), Colombo (Sri Lanka), Port Said (Ägypten) sowie Beteiligungen in Rotterdam, Antwerpen und Zeebrugge.
Diese Infrastrukturinvestitionen erfolgen über verschiedenste Mechanismen:
- langfristige Pachtverträge
- direkte Eigentumsanteile
- exklusive Betreiberrechte oder
- Kooperationsabkommen mit lokalen Behörden.
Dabei zielt China nicht nur auf wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch auf geopolitischen Einfluss. Durch die Kontrolle über Schlüsselhäfen entlang der Seewege Asien–Europa–Afrika kann China indirekt, aber äußerst wirkungsvoll Handelsströme lenken, Abhängigkeiten schaffen und sich im Ernstfall strategische Vorteile sichern.
Gravierende Auswirkungen auf die internationale Schifffahrt
Für Reedereien sind die Folgen dieser geopolitischen Machtverschiebung gravierend:
- Es entsteht erstens eine strategische Abhängigkeit von chinesisch kontrollierten Häfen, die in Krisenzeiten zum Nachteil westlicher Akteure genutzt werden könnte. So könnten bei einem Konflikt um Taiwan oder im Falle eines eskalierenden Handelskrieges bestimmte Häfen für westliche Reedereien blockiert oder mit restriktiven Maßnahmen belegt werden.
- Die starke Konzentration chinesischer Terminalbeteiligungen führt zweitens zu einer reduzierten Wettbewerbssituation. Weniger Wettbewerber bedeuten weniger Verhandlungsspielraum für Reedereien, höhere Abfertigungsgebühren und eingeschränkte Flexibilität bei Routenanpassungen. Diese Entwicklung trifft insbesondere kleinere und mittelgroße Marktteilnehmer, die weniger Ressourcen für Alternativstrategien haben.
- Es bestehen drittens erhebliche Reputationsrisiken. Westliche Verlader, Versicherer und Großkunden betrachten Kooperationen mit chinesischen Terminalbetreibern zunehmend kritisch – nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus sicherheits- und datenschutzrechtlichen Gründen. Dies kann zu einer verstärkten Prüfung der genutzten Häfen und Partner führen, was sich letztlich auch auf das Geschäftsergebnis auswirken kann.
Auswirkungen auf globale Logistikunternehmen
Für globale Logistikdienstleister ergeben sich ähnliche Herausforderungen. Die zunehmende Unsicherheit in geopolitischen Brennpunkten wie dem Südchinesischen Meer, der Straße von Hormus oder dem Suezkanal zwingt Unternehmen dazu, ihre Routennetze zu überdenken. Chinesisch kontrollierte Häfen in geopolitisch sensiblen Regionen könnten im Krisenfall politisch instrumentalisiert werden, was zu plötzlichen Sperrungen, Verzögerungen oder Umleitungen führen kann.
Darüber hinaus werden Compliance- und Sanktionsanforderungen verschärft, vor allem in den USA und Europa. Logistikunternehmen müssen Eigentümerstrukturen transparent machen, chinesische Beteiligungen sorgfältig prüfen und regulatorische Auflagen erfüllen. Verstöße können zu Geldbußen, Reputationsschäden oder gar Geschäftsausschlüssen führen.
Digitale Abhängigkeit
Ein oft unterschätztes Risiko liegt in der digitalen Abhängigkeit. Viele chinesische Hafenbetreiber setzen auf hochintegrierte digitale Plattformen, die nicht nur operative Prozesse steuern, sondern auch wertvolle Datenströme erzeugen. Diese Plattformen verwalten Terminalmanagementsysteme, Ladungsabfertigung, Zollabwicklung, Slot-Management, Lagerlogistik und Echtzeit-Tracking – sie bilden damit das digitale Rückgrat moderner Häfen. Für westliche Logistikunternehmen ergeben sich daraus erhebliche Herausforderungen, die weit über Effizienzfragen hinausgehen.
Zunächst entstehen Fragen der Datensouveränität und des Datenschutzes. Wer hat Zugriff auf die Daten? Wo werden sie gespeichert? Wer darf sie auswerten oder mit Dritten teilen? Gerade bei chinesischen Betreibern ist oft nicht transparent, in welchem Umfang Betriebsdaten gesammelt und verarbeitet werden. Dazu zählen nicht nur technische Informationen wie Ankunftszeiten, Containerbewegungen oder Umschlagzahlen, sondern auch kommerzielle Daten zu Kunden, Preisen, Transportvolumen, Herkunfts- und Zielorten. Diese Daten bilden eine wertvolle Grundlage für Marktanalysen und Wettbewerbsstrategien und können, wenn sie in falsche Hände geraten, erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen.
Cybersicherheit
Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Cybersicherheit. Hochautomatisierte Häfen sind ein attraktives Ziel für Cyberangriffe – sei es durch staatliche Akteure, Cyberkriminelle oder politisch motivierte Gruppen. Angriffe auf Hafen-IT-Systeme können zu Betriebsunterbrechungen, Sabotageakten oder Manipulationen führen, die ganze Lieferketten gefährden. Besonders riskant wird es, wenn westliche Schiffe und Systeme direkt mit chinesischen Plattformen verbunden sind, da dadurch Einfallstore für Malware oder Spionagesoftware entstehen können.
Wirtschaftsspionage
Damit eng verbunden ist die Gefahr der Wirtschaftsspionage. Durch die Analyse der über die Plattformen gewonnenen Daten können Betreiber tiefgehende Einblicke in das Geschäftsverhalten westlicher Unternehmen gewinnen: Welche Routen sind profitabel? Welche Warenströme laufen regelmäßig? Welche Kunden haben welche Marktstellung? Diese Informationen können nicht nur zu kommerziellen Zwecken, sondern auch zur politischen Einflussnahme genutzt werden, etwa um in Krisenzeiten gezielt Druck auf bestimmte Marktakteure auszuüben.
Das sollten Sie angehen: Handlungsempfehlungen für Reedereien und Logistikunternehmen
Für Reedereien und Logistikunternehmen bedeutet das, dass sie nicht nur auf organisatorischer Ebene, sondern auch auf der Ebene der technischen Anbindung ihrer Schiffe und Systeme handeln müssen, um die Risiken zu reduzieren:
- Minimaler Datenaustausch: Nur die zwingend notwendigen Betriebsdaten sollten mit Hafenplattformen geteilt werden; zusätzliche Datensätze müssen aktiv blockiert oder anonymisiert werden.
- Verschlüsselung & Zugangskontrollen: Datenübertragungen müssen verschlüsselt und über sichere Protokolle abgewickelt werden, ergänzt durch strenge Zugangs- und Authentifizierungskontrollen.
- IT-Systemsegmentierung an Bord: Kritische Schiffssysteme wie Maschinensteuerung oder Navigation müssen strikt von den Kommunikations- und Abwicklungssystemen mit dem Hafen getrennt bleiben, um eine Ausbreitung potenzieller Angriffe zu verhindern.
- Regelmäßige Sicherheitsupdates: Die Bord-IT sollte kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten werden, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen.
- Cyberresilienz-Training: Schiffsbesatzungen und Landpersonal müssen für Cyberrisiken sensibilisiert und im Umgang mit potenziellen Sicherheitsvorfällen geschult werden.
- Verträge & Auditierung: Bei Hafenverträgen sollten spezifische Datenschutz-, Cybersecurity- und Audit-Klauseln vereinbart werden, die eine regelmäßige Überprüfung der Plattformen und eine unabhängige Sicherheitsbewertung ermöglichen.
Chancen und notwendige Vorsichtsmaßnahmen
Trotz der beschriebenen Risiken bieten die chinesischen Häfen entlang der maritimen Seidenstraße auch zahlreiche Vorteile: modernste Infrastruktur, hohe Automatisierung, attraktive Transitzeiten und Zugang zu neuen Märkten. Gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern sind chinesische Investitionen oft ein entscheidender Treiber für Effizienzsteigerungen.
Dennoch müssen Logistikunternehmen gezielte Vorsichtsmaßnahmen treffen:
- Routendiversifizierung: Aufbau redundanter Netzwerke durch alternative Häfen in Indien, Südamerika oder dem Mittelmeerraum
- Frühwarnsysteme: Implementierung politischer Risikoanalysen, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und Routen schnell anpassen zu können
- Compliance-Optimierung: sorgfältige Prüfung chinesischer Beteiligungen und rechtliche Absicherung bei Vertragsgestaltungen
- Digitale Resilienz: Entwicklung eigener Plattformstrategien und Investitionen in unabhängige Dateninfrastrukturen
Fazit: Resilienz statt Abhängigkeit als Wettbewerbsvorteil – handeln Sie jetzt
Die maritime Seidenstraße ist weit mehr als ein logistisches Netzwerk – sie ist ein geopolitisches Instrument, das Chinas wachsenden Einfluss auf den Welthandel widerspiegelt. Für Reedereien und Logistikunternehmen geht es heute nicht mehr nur um Effizienz und Kostenoptimierung, sondern um strategische Resilienz. Wer die Herausforderungen dieser neuen Ära erkennt, kann durch Diversifizierung, Risikomanagement und vertrauenswürdige Partnerschaften nicht nur Risiken minimieren, sondern sich auch Wettbewerbsvorteile sichern. Die Verzahnung von Infrastruktur, Geopolitik und Recht stellt die Branche vor neue Aufgaben – und eröffnet zugleich Chancen für die Entwicklung robuster, zukunftsfähiger Logistiknetzwerke.