The Weaponization of Everything
Ob Öl, seltene Erden oder ganze Lieferketten: In geopolitischen Rivalitäten kann alles zur Waffe werden. In seiner monatlichen Kolumne für AKE | SKABE analysiert Prof. Dr. Carlo Masala das Phänomen der „Weaponization“ und erklärt, warum Unternehmen und Staaten sich auf diese neue Realität einstellen müssen.

Prof. Dr. Carlo Masala ist Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und leitet an der Universität der Bundeswehr München u. a. das Center for Intelligence and Security Studies (CISS). AKE | SKABE unterstützt er als wissenschaftlicher Berater und veröffentlicht u. a. exklusive Beiträge zu sicherheitspolitischen und geostrategischen Themen.
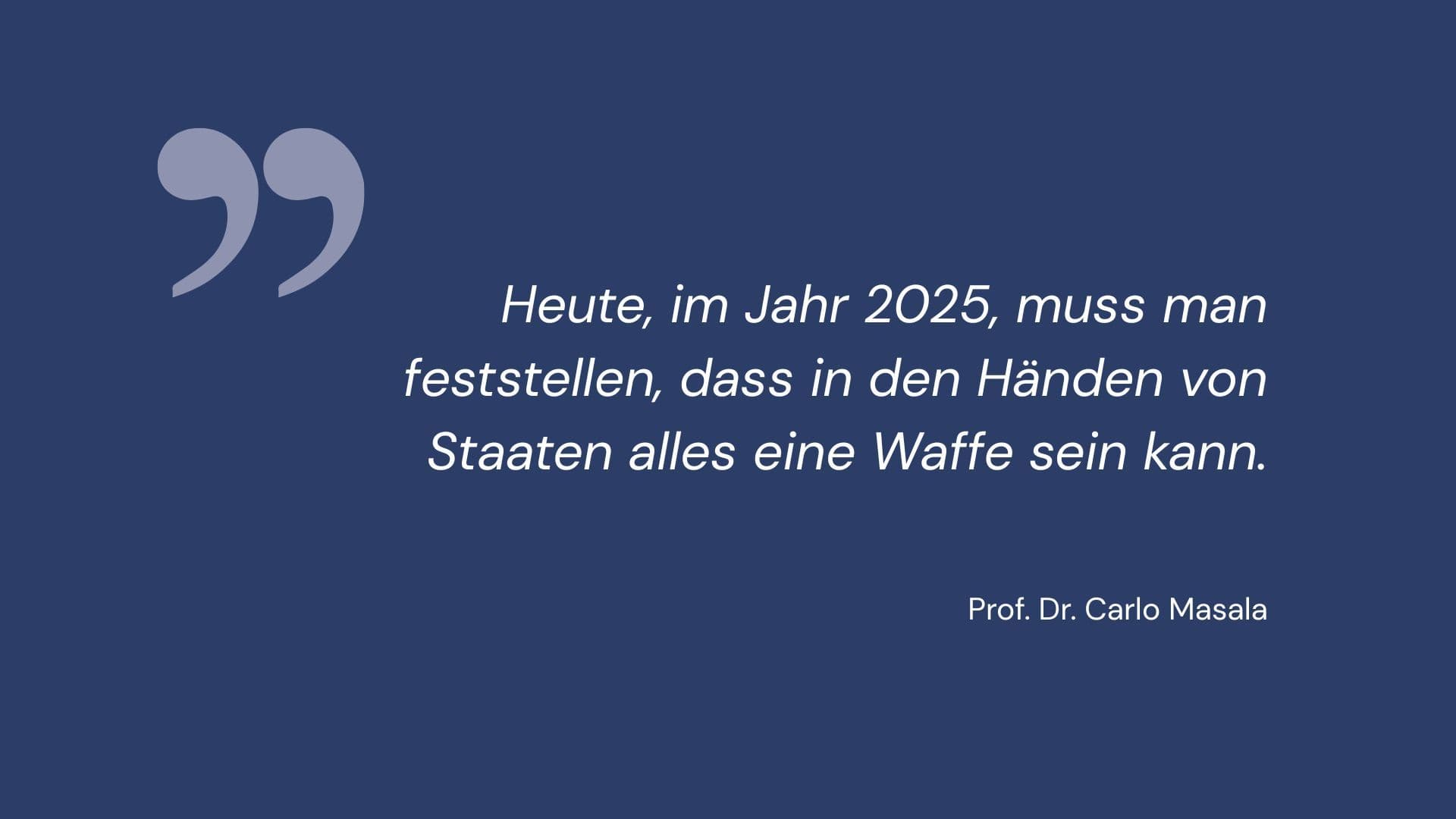
Dinge als Waffe zu benutzen, um anderen Akteuren den eigenen politischen Willen aufzuzwingen oder ihn von bestimmten Verhaltensweisen abzuschrecken, ist nicht wirklich neu. Wir erinnern uns an die 1970er-Jahre, als die OPEC Ölfördermengen erhöhte bzw. reduzierte, oder an die bis heute anhaltenden, gelenkten Migrationsströme durch Belarus.
Von Rohstoffen bis Migration – die Bandbreite der „Waffen“ ist groß
In der Wissenschaft wird dieses Phänomen in jüngster Zeit mit dem Wort Weaponization versehen. Insbesondere im Zusammenhang mit Migration hat die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Kelly M. Greenhill im Jahr 2010 diesen Begriff geprägt.
Heute, im Jahr 2025, muss man feststellen, dass in den Händen von Staaten alles eine Waffe sein kann. Nicht nur Öl oder Menschen, sondern einfach alles. So hat China für eine gewisse Zeit seine Exporte an Baumwoll-Linters nach Europa eingestellt. Diese Linters werden zur Herstellung von Nitrozellulose (auch bekannt als Schießbaumwolle) verwendet, die ein zentraler Bestandteil des Treibladungspulvers für Artilleriegeschosse ist.
Wohlgemerkt, der temporäre Exportstopp kam zu einer Zeit, als Europa Anstrengungen unternahm, die eigene Produktion von Artilleriemunition für die ukrainischen und die eigenen Streitkräfte zu steigern.
Chinas strategische Exportstopps als Machtinstrument im Zollstreit
Es war auch China, das unlängst im Zollstreit mit den USA nicht nur den Export seltener Erden in die USA eingeschränkt hat, um der Trump-Administration ihre eigene Verwundbarkeit von China vor Augen zu führen (etwas, das man nachvollziehen kann), sondern selbigen Export auch nach Europa eingeschränkt hat, um europäische Staaten davon abzuhalten, sich im Zollstreit zwischen den USA und China möglicherweise an die Seite der USA zu stellen.
Lieferketten als neue Konfliktachse
Damit werden Lieferketten politisiert und zu einer der zentralen „Achse neuer Konflikte“, wie es der Politikwissenschaftler Milan Babić in seinem äußerst lesenswerten Buch Geoökonomie. Anatomie der neuen Weltordnung unlängst feststellte (Babić, 2025, S. 122).
Die Schattenseiten der Globalisierung
Letzten Endes erleben wir gerade die Schattenseiten der Globalisierung. Die ökonomische Globalisierung führte in den vergangenen Jahrzehnten zu einer immer engeren wirtschaftlichen Verflechtung aller Staaten der Welt durch den zunehmenden Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften. Diese ökonomische Globalisierung erlebt nun, da die machtpolitischen Rivalitäten zwischen Staaten an Schärfe zunehmen, ihre Politisierung und insbesondere ihre Weaponization.
Vom Win-win zur strategischen Abhängigkeit
War die Globalisierung – auch mit dem Aufbau ihrer globalen Lieferketten – in den letzten Jahrzehnten eher unpolitisch und wurde als Win-win-Situation für alle von allen Seiten perzipiert, so erleben Staaten, die am receiving end von solchen Ketten stehen, die Schattenseiten. Die Senderseite kann nämlich, wenn sie es für notwendig erachtet, den Lichtschalter an- und ausschalten, je nach Bedarf und Interesse.
Und damit wird plötzlich alles zu einer potenziellen Waffe.
Literaturverzeichnis:
Babić, M. (2025). Geoökonomie. Anatomie der neuen Weltordnung. edition suhrkamp.
(Foto: © Christoph Busse)


